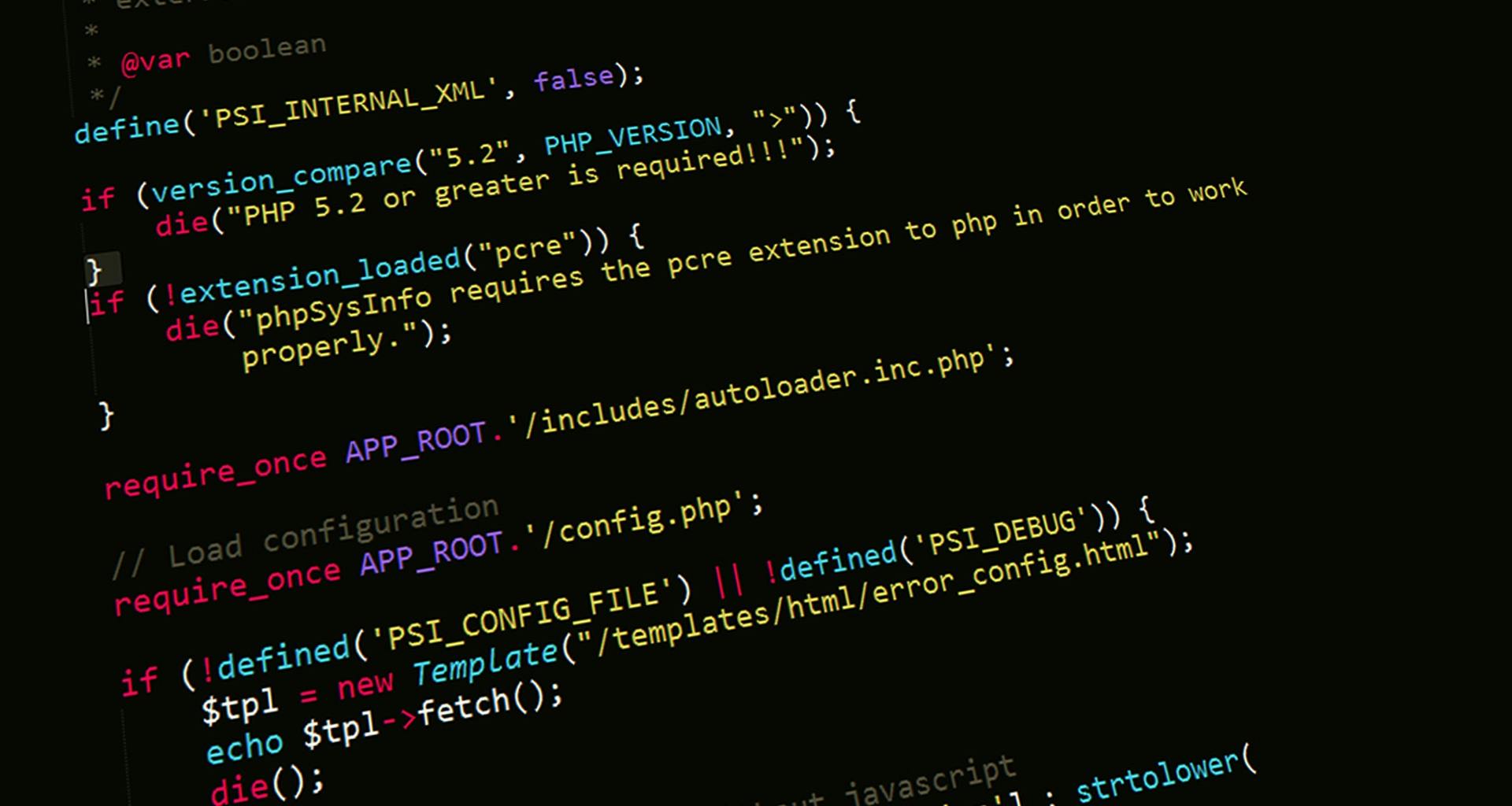Künstliche Intelligenz in der Arbeitsmedizin – Zwischen Hoffnung und Verantwortung
Erschienen im IPA Journal 01/2025
Interview mit Prof. Dr. Julia Krabbe, Leiterin des Kompetenz-Zentrums Medizin am Institut für Prävention und Arbeitsmedizin (IPA)
Künstliche Intelligenz (KI) ist längst keine ferne Zukunftsvision mehr – sie ist dabei, die Medizin grundlegend zu verändern. In der Diagnostik, Prävention und Therapie eröffnet sie neue Möglichkeiten, bringt aber auch ethische und praktische Herausforderungen mit sich. Besonders in der Arbeitsmedizin ist der Einsatz von KI ein viel diskutiertes Thema. Im Interview mit dem IPA Journal gibt Prof. Dr. Julia Krabbe Einblicke in Chancen und Risiken dieser Technologie.
Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?
KI beschreibt Technologien, die versuchen, menschliches Denken nachzuahmen: Sie erkennen Muster, analysieren große Datenmengen und treffen Entscheidungen. Zentral dabei sind Methoden wie maschinelles Lernen, neuronale Netze oder Natural Language Processing (NLP). Während maschinelles Lernen auf Datentraining basiert, sind neuronale Netze für komplexe Aufgaben wie die Erkennung von Lungenerkrankungen auf Röntgenbildern geeignet. NLP wiederum kommt z. B. bei virtuellen Assistenten oder automatischer Textanalyse zum Einsatz.
KI im Einsatz – was bedeutet das für die Arbeitsmedizin?
KI kann die Arbeitsmedizin auf verschiedenen Ebenen unterstützen:
-
Frühzeitige Diagnosen: KI erkennt Muster in Bildgebungen oder Labordaten, die menschlichen Ärzten möglicherweise entgehen. So kann sie z. B. helfen, asbestbedingte Lungenerkrankungen früher zu erkennen.
-
Risikobewertung: Durch die Auswertung von Gesundheits- und Expositionsdaten kann KI individuelle und gruppenspezifische Gefährdungen am Arbeitsplatz identifizieren.
-
Betriebliche Gesundheitsförderung: Wearables liefern Daten in Echtzeit – KI kann daraus individuelle Empfehlungen ableiten, um Belastungen zu reduzieren oder frühzeitig gegenzusteuern.
Von der Forschung in die Praxis
Im Rahmen einer Studie an der Uniklinik Aachen untersuchte das IPA-Team unter der Leitung von Prof. Krabbe den Einsatz von ChatGPT zur medizinischen Recherche. Das Ergebnis: Die KI kann medizinisches Fachwissen effizient zusammenfassen – für komplexe Entscheidungen bleibt die ärztliche Expertise jedoch unverzichtbar. KI ist damit ein hilfreiches Werkzeug, aber kein Ersatz für menschliche Urteilskraft.
Ethische Fragen: Wer trägt die Verantwortung?
Der Einsatz von KI in sensiblen Bereichen wie der Arbeitsmedizin wirft gewichtige ethische Fragen auf:
-
Transparenz: Entscheidungen von KI-Systemen müssen nachvollziehbar sein – vor allem, wenn sie über Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit mitentscheiden.
-
Diskriminierungsrisiken: Wenn KI-Modelle mit unausgewogenen Daten trainiert werden, können Vorurteile verstärkt werden. Umso wichtiger ist eine sorgfältige Datenauswahl.
-
Verantwortung: Wer haftet bei Fehlentscheidungen? Auch hier braucht es klare Regeln und transparente Strukturen.
Datenschutz als zentrale Voraussetzung
Gerade im medizinischen Bereich ist Datenschutz unerlässlich. Die Anonymisierung von Patientendaten, dezentrale Datenverarbeitung und verschlüsselte Übertragung sind Maßnahmen, die Prof. Krabbe als unverzichtbar nennt. Außerdem gelten weiterhin alle bestehenden ärztlichen Schweigepflichten und datenschutzrechtlichen Vorgaben.
Wird KI den Arzt ersetzen?
Die Antwort von Prof. Krabbe ist eindeutig: Nein. KI kann das ärztliche Handeln sinnvoll ergänzen – zum Beispiel bei Routinetätigkeiten oder durch präzise Datenanalysen. Aber Empathie, Erfahrung und das individuelle Urteil eines Arztes oder einer Ärztin sind durch keine Maschine zu ersetzen.
KI in der gesetzlichen Unfallversicherung: Große Potenziale
Für Unfallversicherungsträger bietet KI wertvolle Analysewerkzeuge: Sie kann Unfallstatistiken auswerten, Risikoprofile erstellen und auf Grundlage von Expositions- oder Belastungsdaten gezielte Präventionsmaßnahmen vorschlagen. Echtzeitsensoren könnten sogar frühzeitig gefährliche Situationen erkennen und warnen, bevor ein Unfall passiert.
Ein Blick in die Zukunft
Noch befindet sich der großflächige KI-Einsatz in der Arbeitsmedizin in einer frühen Phase – viele Anwendungen sind Pilotprojekte. Doch Prof. Krabbe rechnet damit, dass KI in fünf bis zehn Jahren ein integraler Bestandteil der medizinischen Praxis sein wird. Vor allem in der individualisierten Prävention, der datenbasierten Diagnostik und dem effizienten Risikomanagement wird KI eine Schlüsselrolle spielen.
Fazit:
Künstliche Intelligenz ist weder Allheilmittel noch Bedrohung – sondern ein mächtiges Werkzeug, das verantwortungsvoll genutzt werden muss. In der Arbeitsmedizin kann sie helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, Versorgung zu verbessern und Ressourcen gezielter einzusetzen. Aber sie braucht klare ethische Leitplanken, transparente Systeme und immer einen menschlichen Entscheidungsträger an ihrer Seite.
„KI wird uns unterstützen – aber niemals ersetzen.“
– Prof. Dr. Julia Krabbe